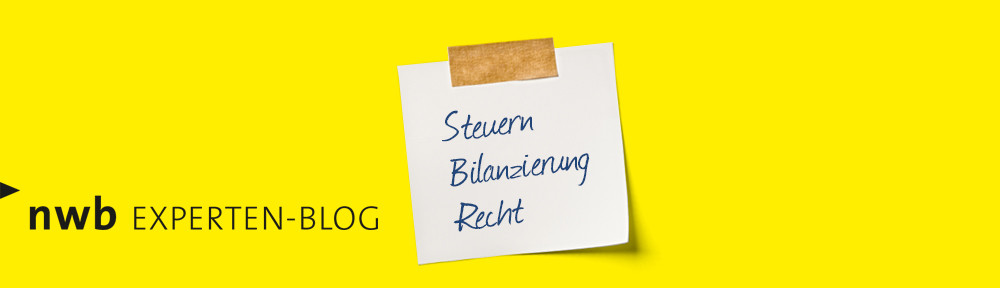Unternehmen, die (in NRW) nach Erhalt von Corona-Soforthilfen ihren tatsächlichen Liquiditätsengpass zurückgemeldet und einen entsprechenden Schlussbescheid über eine (Teil)-Rückzahlung bekommen und hiergegen nicht geklagt haben, haben keinen Anspruch auf Wiederaufgreifen des Verfahrens (OVG Münster, Beschluss v. 11.7.2024 – 4 A 1764/23).
Hintergrund
Unternehmen und Selbständige, die sich in der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 in einem coronabedingten Liquiditätsengpass befanden, konnten Corona-Soforthilfen zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen beantragen. Zahlreiche Empfänger von Soforthilfen hatten später in NRW von den Bezirksregierungen ein Wiederaufgreifen ihrer Verfahren begehrt, nachdem einige Verwaltungsgerichte und das OVG Münster rechtzeitig angegriffene Schlussbescheide für rechtswidrig gehalten hatten – ich hatte im Blog berichtet.
Die Bezirksregierungen in NRW haben ein Wiederaufgreifen jeweils abgelehnt, auch angesichts eines entsprechenden Beschlusses der Landesregierung (LT-Vorlage 18/2118/landtag.nrw.de). Danach haben verschiedene Verwaltungsgerichte in NRW entschieden, dass die im Ermessen der Behörden stehende Ablehnung des Wiederaufgreifens rechtlich nicht zu beanstanden war; das hat das OVG Münster jetzt bestätigt.
Wiederaufgreifen bestandskräftiger Verfahren
Was lässt sich aus der OVG-Entscheidung ableiten? Die grundsätzliche Rechtsbeständigkeit unanfechtbarer Verwaltungsakte ist ein wesentlicher Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit, die dem Gebot der Rechtssicherheit Rechnung trägt. Dem entspricht, dass selbst objektiv rechtswidrige Verwaltungsakte bei Bestandskraft vollstreckungsfähig sind. Über das Wiederaufgreifen bestandskräftig abgeschlossener Verfahren entscheidet die Behörde in einem eigenem Verwaltungsverfahren (§ 9 VwVfG). Außerhalb eines Rechtsbehelfsverfahrens hat die Behörde ein doppeltes Ermessen: Weiterlesen →