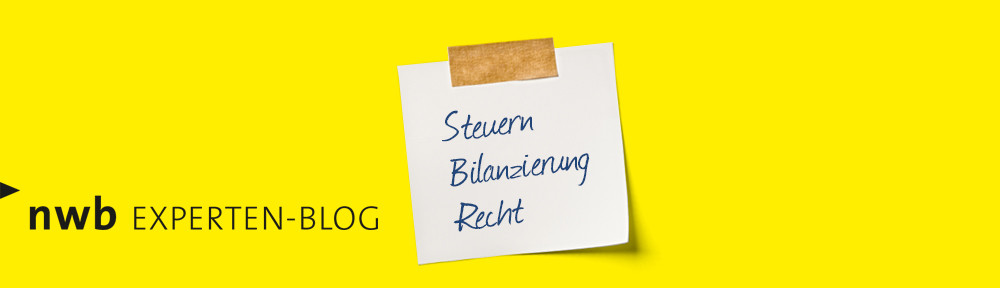Der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines Dienstwagens zu privaten Zwecken wird entweder per Ein-Prozent-Regelung oder nach der Fahrtenbuch-Methode ermittelt. Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den laufenden Kosten mindern den geldwerten Vorteil (vgl. BMF-Schreiben vom 21.9.2017, BStBl I 2017 S. 1336, Rz. 4). Dies gilt nach Auffassung des FG Köln auch, wenn Arbeitnehmer an ihren Arbeitgeber für ihren Firmenwagen Miete für einen Parkplatz zahlen bzw. wenn sie Zuzahlungen für einen vom Arbeitgeber angemieteten Parkplatz entrichten (FG Köln, Urteil vom 20.4.2023, 1 K 1234/22).
Der Sachverhalt:
Der Arbeitgeber ermöglichte seinen Beschäftigten, an oder in der Nähe der Arbeitsstätte einen Parkplatz für monatlich 30 Euro anzumieten. Einigen Beschäftigten standen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Der geldwerte Vorteil wurde nach der Ein-Prozent-Regelung berechnet. Hierbei zog der Arbeitgeber die von den Beschäftigten an ihn gezahlte Stellplatzmiete ab. Das Finanzamt war hingegen der Auffassung, dass die Mietzahlungen den pauschalen Nutzungswert nicht mindern dürften. Doch das FG folgte der Ansicht des Arbeitgebers.
Begründung:
Es fehle hinsichtlich der Miete für den Stellplatz an einer Bereicherung der Arbeitnehmer und damit an einer Grundvoraussetzung für das Vorliegen von Arbeitslohn. Die Stellplatzmiete mindere bereits auf der Einnahmeseite den Vorteil aus der Firmenwagenüberlassung. Diese Minderung des Nutzungsvorteils trete unabhängig davon ein, ob die Miete für den Stellplatz freiwillig geleistet werde oder zur Erfüllung einer arbeitsvertraglichen Klausel oder zur Inbetriebnahme des Fahrzeugs erforderlich sei.
Denkanstoß:
Es wurde die Revision zugelassen, die auch bereits unter dem Az. VI R 7/23 beim BFH anhängig ist (Quelle: FG Köln, Pressemitteilung vom 10.11.2023). Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen
Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass der BFH den Kölner Kollegen widersprechen wird. Allerdings hat der BFH erst kürzlich zu Lasten der Steuerpflichtigen über den Fall entschieden, dass ein Dienstwagen in der privaten Garage untergestellt wird. Der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines Firmenwagens zur privaten Nutzung ist danach nicht um die Garagen-AfA zu mindern, wenn keine rechtliche Verpflichtung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber besteht, das Fahrzeug in der Garage unterzustellen (BFH-Urteil vom 4.7.2023, VIII R 29/20). Letztlich geht es in beiden Fällen – im weitesten Sinn – um „Zuzahlungen zu den laufenden Kosten“ des Kfz. Nur einmal halt um Zuzahlungen zum Parkplatz des Arbeitgebers und einmal um Kosten für einen eigenen Stellplatz.