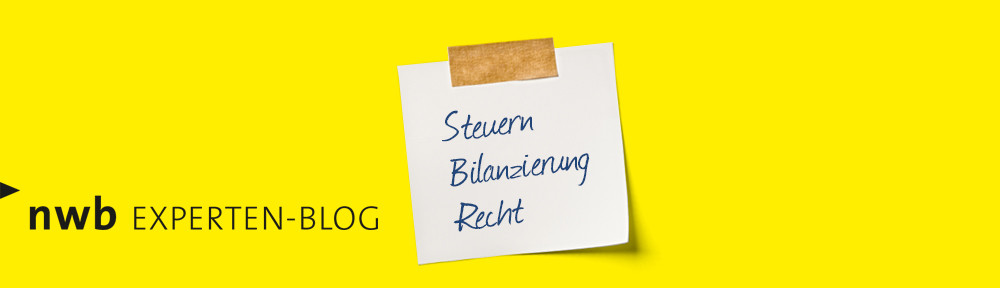Am 5.6.2024 hat der Bundestag in namentlicher Abstimmung die Forderung nach Abschaffung des Solidaritätszuschlags erneut zurückgewiesen. Die Frage bleibt aber, wann und wie der Bundestag den „Soli“ neu regeln will.
Hintergrund
Der ursprünglich befristete Soli von 1991 zur Finanzierung des Golf Krieges war bis Mitte 1992 befristet, wurde dann Mitte der 90er Jahre aber zur Finanzierung der Zusatzlasten aus der deutschen Wiedervereinigung eingeführt. Er wurde durch das Solidaritätszuschlagsgesetz (SolzG 1995, BGBl. 1995 I S. 1959) entfristet. Seit etlichen Jahren wird um die Abschaffung dieser Ergänzungsabgabe (Art. 106 GG) gerungen, auch vor den Finanzgerichten bis hin zum BVerfG. Nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II Ende 2019 erfolgte die Reform des Soli ab VZ 2020. Im Gesetz zur Rückführung des Solidaritätsausgleichs aus dem Jahr 2019 beschloss die damalige Große Koalition, dass Besserverdiener – die oberen 10% der Einkommen – den Zuschlag weiterhin zahlen müssen, die übrigen 90% wurden ausgenommen. Seitdem die Erhebung auf rund 10 Prozent „Besserverdienende“ beschränkt ist, wird darum gestritten, ob diese Ungleichbehandlung der Steuerzahler noch verfassungsmäßig ist.
Bundestag folgt ablehnender Beschlussempfehlung des Finanzausschusses
Die Fraktion der AfD hatte die vollständige Abschaffung des Soli beantragt (BT-Drs.20/11149), allerdings ohne ein Finanzierungskonzept für den hierbei entstehenden Steuerausfall in Höhe von rund 11 Mrd. Euro/Jahr vorzulegen. Deswegen war absehbar, dass dieser Antrag schon deshalb im Bundestag keinen Erfolg haben wird.
Interessant sind aber die Einlassungen der anderen Fraktionen im Finanzausschuss, deren Empfehlung der Bundestag schließlich gefolgt ist: Weiterlesen